Gastbeitrag von Julia Roos
Bereits seit längerem, aber verstärkt seit den Stadtratsbeschlüssen in Dresden und Leipzig, wird in Sachsen über die Neugründung eines Jüdischen Museums diskutiert. Doch was ist eigentlich ein Museum? Der Internationale Museumsrat ICOM hat gerade eine erhitzte Debatte über diese Frage hinter sich. Nach knapp sechs Jahren, mehreren Mitgliederforen, zahlreichen Beschlussvorlagen und einigen Rücktritten verabschiedete die Außerordentliche Generalversammlung im Sommer 2022 eine Neufassung ihrer Museumsdefinition. Diese war nicht die erste und auch keiner der bisherigen Findungsprozesse verlief konfliktfrei.
Die Geschichte von Museen und Museumsdefinitionen zeigt, dass die Institution, so statisch sie auf den ersten Blick wirkt, doch von einem stetigen Wandel geprägt ist. In ihrem Selbst- und Fremdverständnis spiegeln sich gesellschaftliche Entwicklungen. Museen sind keine isolierten Einrichtungen, sondern agieren in einem Spannungsfeld aus Gesellschaft, Politik und Wissenschaft. In jeder Museumsdefinition und in jeder Museumsneugründung zeigt sich das Zeittypische; Museumsgeschichte ist immer auch Gesellschaftsgeschichte.
Deswegen wirft dieser Blogbeitrag die Frage auf, was ein Jüdisches Museum ist, was von ihm erwartet wird und für wen es wann wo und warum relevant ist, jüdische Vergangenheiten museal zu präsentieren. Er lotet aus, inwiefern es gewinnbringend ist, die sächsische Debatte über die Neugründung eines Jüdischen Museums in einem historischen sowie überregionalen Kontext zu betrachten.

Die Geschichte Jüdischer Museen ist nicht nur durch stetigen Wandel, sondern durch eine klare Zäsur geprägt: den Holocaust. Jüdische Museen entstanden im Europa des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts in Folge von Modernisierungs- und Säkularisierungsprozessen, vergleichbar zu anderen kulturhistorischen Museen. Gegründet wurden sie von Juden mit dem Ziel, die materiellen Zeugnisse der eigenen, häufig individuell nicht mehr gelebten, Religion und Tradition zu bewahren, zu erforschen und zu vermitteln. Die Nationalsozialisten plünderten, schlossen und zerstörten die Häuser und ihre Sammlungen oder nutzten die Artefakte für antisemitische Ausstellungen. Die systematische Vernichtung jüdischen Lebens in Europa führte zu vielen besitzlosen Kulturgütern, entriss Gebäude und Objekte ihrer ursprünglichen Funktion und veränderte die Situation für Jüdische Museen in Europa grundlegend.
Nur an wenigen Orten, etwa in Budapest, wurde der Museumsbetrieb unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgenommen. Im deutschsprachigen Raum kam es erst ab den 1980er Jahren zu Neugründungen oder „Wiedereröffnungen“, meist auf Initiative von Nichtjuden und häufig angestoßen durch „wiederentdeckte“ Gebäude oder Objekte. Seit 1980 wird die Alte Synagoge Essen, seit 1982 das wiederaufgebaute Raschi-Haus in Worms als Jüdisches Museum genutzt, 1985 wurde eine Ausstellung in der Augsburger Synagoge konzipiert. 1988 eröffnete in der DDR nach vier Jahren Sanierung das Museum Synagoge Gröbzig und kurz darauf erfolgte die Grundsteinlegung für das Centrum Judaicum in Ostberlin. In der BRD öffnete zeitlich parallel das Jüdische Museum Rendsburg im Dr. Bamberger-Haus als Teil der Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen seine Türen, kurz darauf das Jüdische Museum Frankfurt im Rothschild-Palais.
Hier zeigt sich bereits eines der Konfliktfelder, die Debatten um Jüdische Museen, und so auch die sächsische, prägen: Im Vorfeld war im Frankfurter Magistrat heftig diskutiert worden, ob das Jüdische Museum als „Teil der gesamtstädtischen Vergangenheit“ eine Außenstelle des Historischen Museums sein sollte. Bei der Gründung des Jüdischen Museums Berlin erreichte die Debatte ihren bisherigen Höhepunkt: Auch dieses sollte zunächst eine Abteilung des Berlin-Museums bleiben. Die Frage nach der Eigenständigkeit Jüdischer Museen oder deren inhaltliche wie strukturelle Integration in Stadt-, Regional- und Landesmuseen ist bis heute eine immer wieder aufs Neue diskutierte Frage.
Ein weiteres Konfliktfeld ist das Verhältnis zu den zeitlich parallel entstehenden NS-Dokumentations- und Informationszentren, etwa die Topographie des Terrors 1987, die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz 1992 oder das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände 2003. Auch hier verlief die Abgrenzung nie vollständig; die meisten Jüdischen Museen behielten einen hybriden Charakter und fungieren auch heute meist ebenfalls als Erinnerungsorte. Die Überschneidung zu Gedenkstätten spiegelt sich in den Überlegungen wider, den Alten Leipziger Bahnhof in Dresden als Standort für ein Jüdisches Museum Sachsen zu wählen.
Inhaltliche wie konzeptionelle Fragen rückt ein anderer Blick in die Geschichte in den Mittelpunkt: der auf größere Ausstellungen zur jüdischen Geschichte und Kultur, die in der BRD seit den 1960er Jahren und in der DDR seit den 1980er Jahren vermehrt konzipiert wurden. Am bekanntesten ist sicher die „Monumenta Judaica“ in Köln 1963, veranstaltet in Reaktion auf die Schändung der gerade wiederaufgebauten Kölner Synagoge an Weihnachten 1959 mit Hakenkreuzen. Anlässlich des 300-jähigen Bestehens der Berliner Jüdischen Gemeinde zeigte das Berlin-Museum 1971 die Schau „Leistung und Schicksal“. Der 50. Jahrestag der Novemberpogrome war Anlass für die Landesausstellung „Siehe der Stein schreit auf der Mauer. Geschichte und Kultur der Juden in Bayern“ im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Ebenfalls 1988 wurden die Ausstellungen „Und lehrt sie: Gedächtnis!“ im Ephraim-Palais in Ostberlin oder „Juden in Leipzig“ im Krochhochhaus in Leipzig gezeigt.
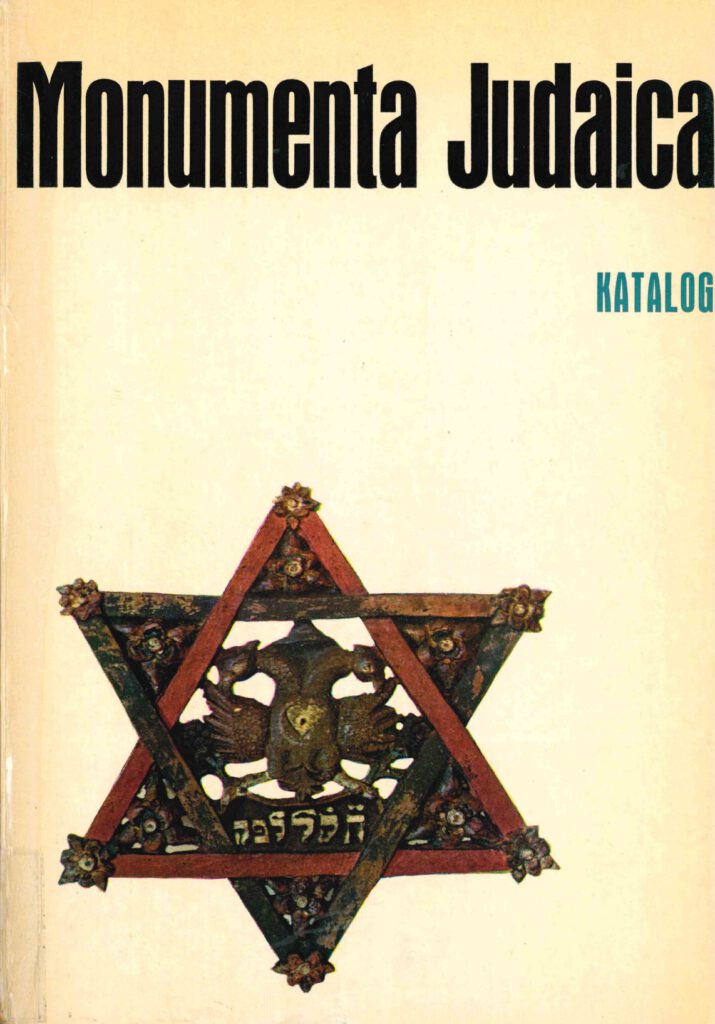


Die Kölner Großausstellung von 1963 wollte, so der damalige Kölner Oberbürgermeister, „das Kontinuierliche, das Gemeinsame, ja, oftmals Brüderliche und Verbindende“ zeigen, Verfolgung und Massenmord wurden nur nachgeordnet in der Ausstellung erzählt. Im Katalog zur Ausstellung „Leistung und Schicksal“ schreibt die Berliner Museumsdirektorin 1971 verklausuliert über das „von Tragik erfüllt gewesene Schicksal der Berliner Juden“, während ihre Leistung für Berlin so groß und vielseitig gewesen sei. Gezeigt wurde eine klassische Beitragsgeschichte; die Verantwortung für Verfolgung und Massenmord ins Unkonkrete verschoben. Dies wirft ein Schlaglicht auf eine der zentralen Fragen der Präsentation jüdischer Geschichte: die nach dem Warum. Denn häufig werden Museumsgründungen oder Ausstellungsprojekte mit gesellschaftspolitischen Erwartungen und Fremdzuschreibungen verknüpft: Antisemitismusprävention, Sensibilisierung für Diversität, die Repräsentanz von Weltoffenheit und Toleranz. So wichtig diese Ziele im Einzelnen sind, so wichtig bleibt es auch, sie zu reflektieren, damit sie das Ausstellungsnarrativ nicht dominieren. Denn oft führen diese, außerhalb des Museumswesens und der Geschichtswissenschaften liegenden Erwartungen an Jüdische Museen dazu, dass die Komplexität jüdischer Geschichte nicht angemessen zum Tragen kommt – und diese auf ein reines Verfolgungsnarrativ reduziert wird, Gemeinsamkeiten überbetont werden oder es zu einer Konzentration auf berühmte jüdische Persönlichkeiten kommt bis hin zu einer Universalisierung dort, wo es um eine partikulare jüdische Erfahrung geht.
Trotz aller Detailkritik lässt sich für die genannten Ausstellungen eine nachhaltige Wirkung aufzeigen: Fast sechzig Jahre später zeigte das Kolumba, das Kunstmuseum des Erzbistums Köln, die Ausstellung „In die Weite. Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland“, mit Bezug auf das Themenjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, aber eben auch in Rückgriff auf die „Monumenta Judaica“. In Berlin kam es 1975 zur Gründung der „Gesellschaft für ein Jüdisches Museum in Berlin“; 1979 konnte im Berlin-Museum eine Stelle für eine Kuratorin eingerichtet werden, die eine jüdische Sammlung aufbaute, den Grundstock des heutigen Jüdischen Museums Berlin. Die Nürnberger Ausstellung regte in der gesamten Region die lokalhistorische Laienforschung weiter an. Es kam zu „Wiederentdeckungen“ von Überresten materieller Kultur, umgenutzter Synagogen oder verwahrlosten Friedhöfen sowie zur Gründung Jüdischer Museen, etwa 1994 in Veitshöchheim oder 1998 in Fürth. Und auch in der DDR entfaltete das Jahr 1988 über die genannten Beispiele hinaus Resonanz, so wurde beispielsweise in Erfurt durch Forschungen einer engagierten Denkmalpflegerin im gleichen Jahr die Alte Synagoge „wiederentdeckt“.
Jüdische Vergangenheiten einer breiteren Öffentlichkeit gegenüber zu verlebendigen, dazu bedarf es also nicht zwingend der Neugründung eines Jüdischen Museums. Ebenso denkbar sind ein landesweites Themenjahr, wenn gut durchdacht und nachhaltig, oder eine größere Sonder- oder gar Landesausstellung. In Bayern erforscht seit Herbst 2021 die Ad hoc-Arbeitsgruppe „Judentum in Bayern in Geschichte und Gegenwart“ archäologische und historische Spuren und vermittelt diese in eine breite Öffentlichkeit. Auch in der Sächsischen Landestelle für Museumswesen oder dem Museumsbund könnte eine längerfristige Stelle geschaffen werden, die kleinere Häuser unterstützt, im Depot jüdische Objekte als solche zu erkennen, deren Provenienz zu klären, sie richtig einzuordnen und klug in die Dauerausstellung zu integrieren.
Gleichzeitig zeigt dieses Schlaglicht auf die Entstehungsgeschichte Jüdischer Museen wie fruchtbar eine überregionale und zeitlich geweitete Perspektive auf die Debatte sein kann. Diese kann als Basis dienen, um nicht nur über Standorte und Objekte eines zukünftigen Jüdischen Museums nachzudenken, sondern auch fundierter über Inhalte, Konzeptionen, Sammlungen und Ziele. Es muss nicht alles neu gedacht oder erfunden werden, sondern man kann hier durchaus aus den Erfahrungen – und auch Fehlern oder Fehlstellen – früherer Ausstellungsprojekte lernen. Entsprechend veranstaltet das Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow in Leipzig im Mai und Juni 2023 eine Vortragsreihe, in deren Mittelpunkt die Gründungsgeschichten, aber auch aktuelle Positionierungen Jüdischer Museen steht.

Foto: Markus Kirchhoff, 2022



